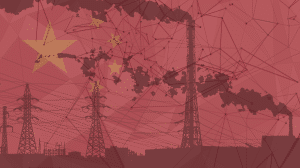Am 29. April 2025 lud die Plattform Industrie 4.0 Österreich zu einem Research Insight unter dem Titel „Chinas Normungsstrategie und digitalisierte Zukunftstechnologien“. Über 30 Teilnehmende verfolgten die Präsentation der im Auftrag der Arbeiterkammer entstandenen Studie durch die Autorin Doris Vogl. In ihrem Vortrag stellte sie die Herausforderungen und Implikationen der chinesischen Normungspolitik für Europa dar.
Normung als geopolitisches Werkzeug
Bereits zu Beginn wurde deutlich: Die chinesische Standardisierungspolitik stellt für europäische Normeninstitutionen, Unternehmen und Regulierungsbehörden ein strategisch relevantes Handlungsfeld dar. Vogl zeigte auf, dass China auf internationaler Ebene zunehmend proaktiv agiert – etwa über geopolitische Initiativen wie das Belt-and-Road-Projekt, im Deutschen als „Neue Seidenstraße“ bekannt. Technische Standards sind hier nicht nur Begleiterscheinung, sondern werden gezielt als integraler Bestandteil von Handelsabkommen eingesetzt – häufig zum Vorteil chinesischer Unternehmen, aber mit potenziellen Marktzugangshürden für europäische Akteure.
Vogl verwies zu Beginn auch darauf, dass sie auf eine strikte Unterscheidung zwischen Normen, Standards und Spezifikationen verzichtet, weil in chinesischen Primärquellen – ebenso wie in vielen englischsprachigen Veröffentlichungen aus chinesischer Feder – eine präzise Differenzierung fehlt; dort ist meist einheitlich von „technical standards“ die Rede.
Unterschiedliche Zugänge zur Standardisierung: China vs. Europa
Einleitend verglich Vogl die normativen Infrastrukturen beider Regionen. China bietet seit 2020 über eine staatlich betriebene Plattform freien Zugang zu nationalen Standards – auch für ausländische Unternehmen. Demgegenüber bleibt der Zugang zu europäischen Normen häufig eingeschränkt. Zwar ebnete ein EuGH-Urteil 2021 in bestimmten Fällen den Weg zu kostenfreiem Zugang, doch bleibt das europäische System stärker durch Urheberrechte und föderale Strukturen fragmentiert. Gleichzeitig wurde deutlich, dass China – angesichts seiner zunehmenden technologischen Führungsrolle etwa im Bereich grüner Technologien – dazu übergeht, strategisch relevantes Wissen länger unter Verschluss zu halten. Der Führungsanspruch auf der einen Seite zwingt die Volksrepublik also auf der anderen Seite in eine Verteidigungsposition.
Von „Made in China 2025“ zu „China Standards 2035“
Ein Rückblick auf die letzten Jahre machte im zweiten Teil der Präsentation deutlich, wie eng Chinas Industrie- und Standardisierungsstrategien miteinander verzahnt sind. Von der Industrieinitiative Made in China 2025 über das daran anschließende Projekt China Standards 2035 bis hin zur 2021 veröffentlichten National Standardization Development Outline verfolgt China langfristig das Ziel, nicht nur technologisch führend zu werden, sondern selbst globale Standards zu setzen. Ein Zitat aus der Strategie veranschaulicht diesen Anspruch:
„First-class companies do standards, second-tier companies do technology, third-tier companies do products.“
Fünfjahrespläne und strategische Industrien
Im Kontext des aktuell auslaufenden 14. Fünfjahresplans sowie der Planungen für den 15. Fünfjahresplan wurde schließlich klar, welche Zukunftsindustrien die chinesische Regierung aktuell fördert – darunter das Internet der Dinge, Smart Cities, KI-basierte Mobilitätslösungen, virtuelle Realität, Quantentechnologie sowie die sogenannte Low-Altitude Economy. Parteiinterne Strukturen in Unternehmen tragen dabei zur konsequenten Umsetzung politischer Vorgaben bei.
Ein bemerkenswertes Detail am Rande: Die Einführung des Begriffs „Produktivkräfte neuer Qualität“, vorgestellt im März 2024 beim Nationalen Volkskongress, zeigt den Versuch, marxistische Wirtschaftskategorien an aktuelle technologische Entwicklungen anzupassen. Unter diesen „Produktivkräften neuer Qualität“ werden übrigens in Abgrenzung zu den klassischen Produktivkräften wie Arbeit, Ressourcen und Kapital die Spitzentechnologie sowie hohe Effizienz und Qualität verstanden. Was passiert wohl, wenn die Technokratie – neben ihrem offensichtlichen Verständnis für Zieldefinition und Strategieentwicklung sowie der Fähigkeit, diese konsequent umzusetzen – auch noch die Agilität für sich entdeckt?
Diskussion und Ausblick
Die chinesische Normungspolitik erweist sich als geopolitisches Instrument mit weitreichenden Auswirkungen auf Wirtschaft, Politik und Wissenschaft in Europa. Nicht nur in der abschließenden Diskussion wurde daher das Ungleichgewicht zwischen Chinas wachsendem Einfluss in internationalen Normungsgremien (z. B. ISO, IEC, ITU) und dem vergleichsweise geringen Engagement europäischer Akteur:innen thematisiert. Doris Vogl sprach sich für eine langfristige und gezielte Entsendung europäischer Expert:innen in diese Gremien aus. Ebenso plädierte sie für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen und innovativen Start-ups, da europäische politische Institutionen möglicherweise auch zukünftig nicht in jenem Ausmaß intervenieren werden, wie es staatliche Einrichtungen Chinas ganz selbstverständlich tun und wohl auch weiter tun werden.
Die Studie steht hier zum Download bereit.
Anmerkung: Die Informationsverarbeitung (Transkription, Zusammenfassung) erfolgte unter Einsatz von KI. Die finale Fassung wurde manuell überprüft und redaktionell überarbeitet.